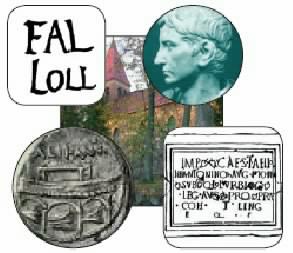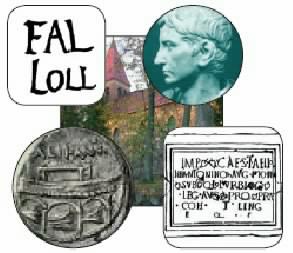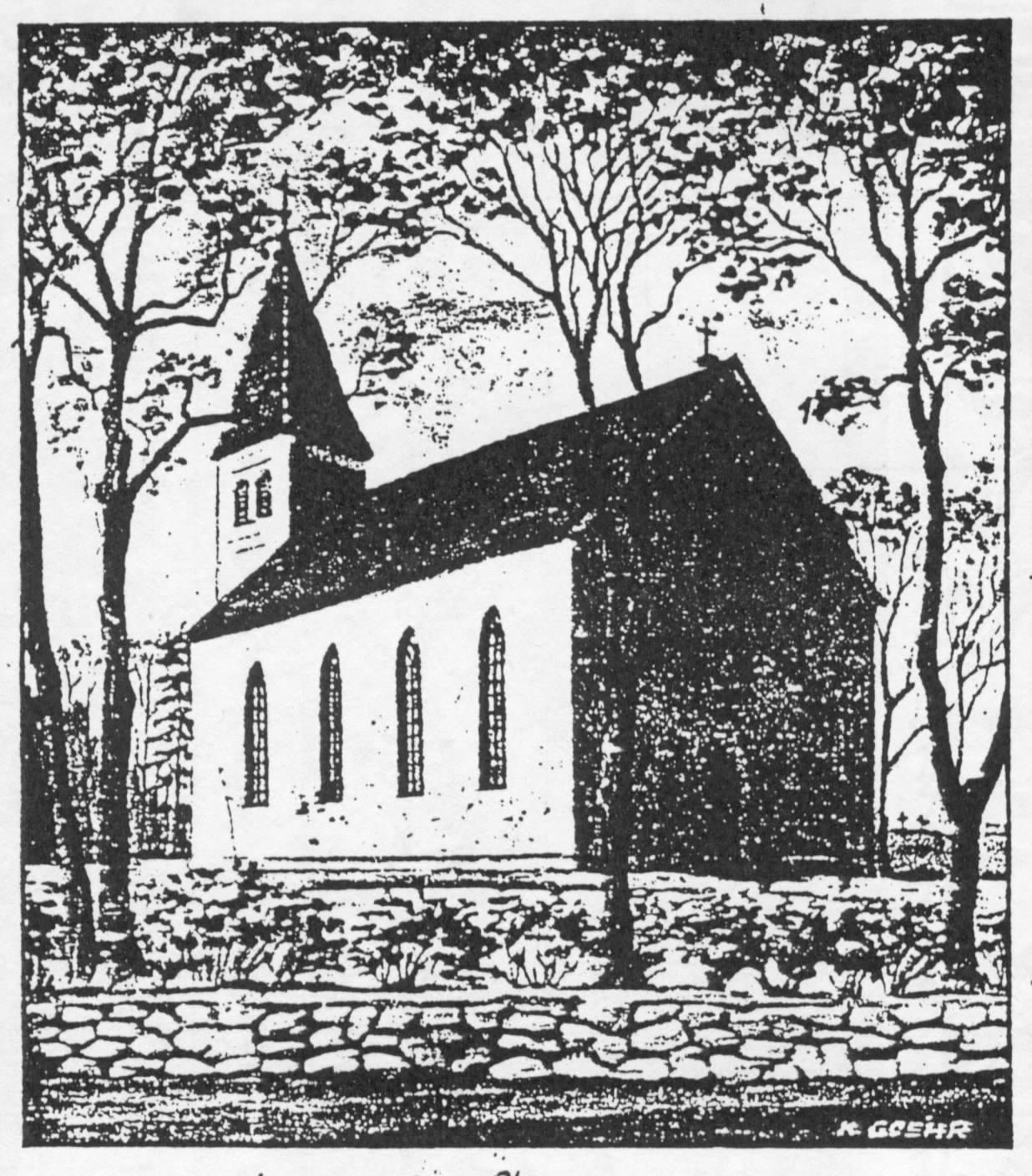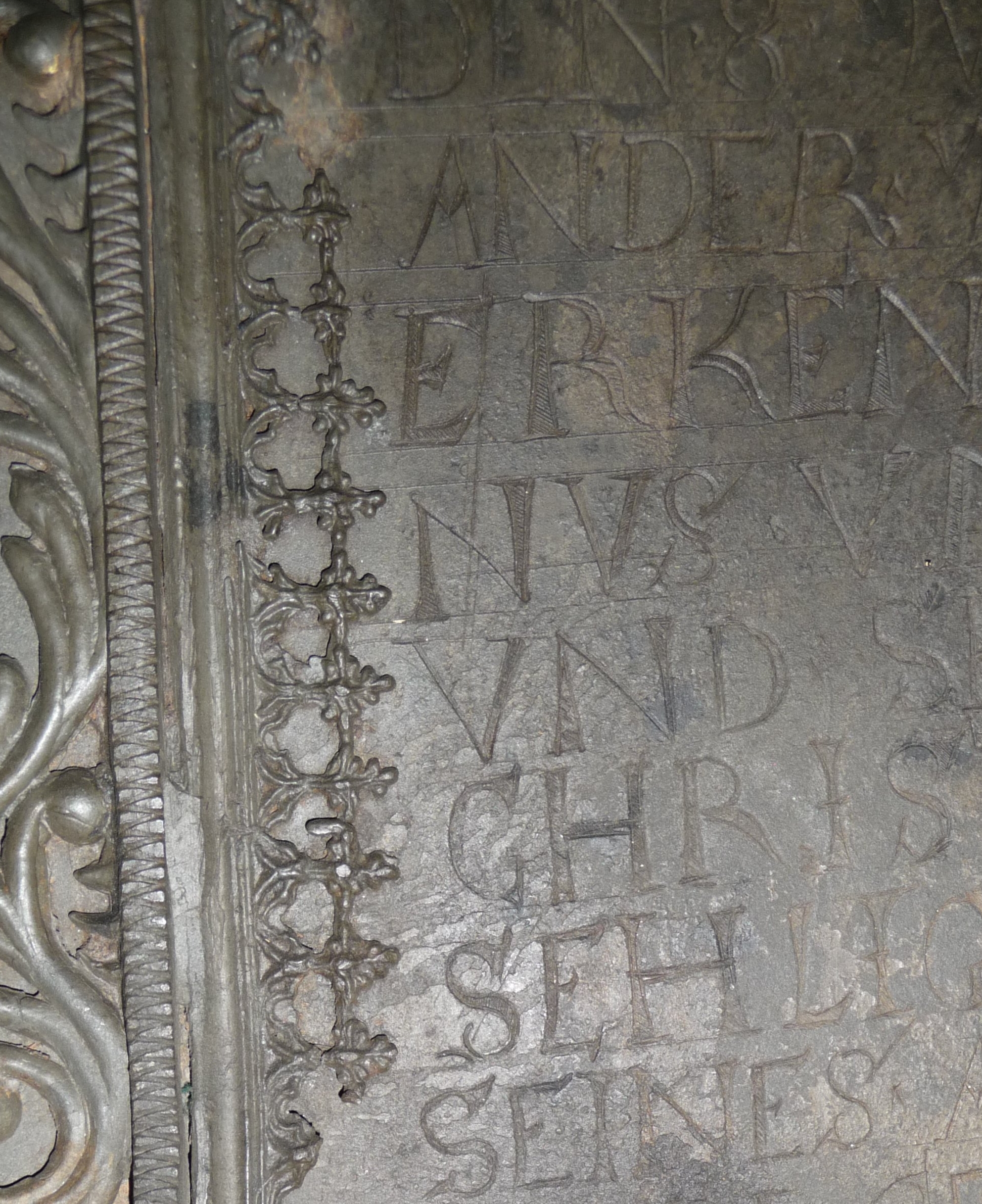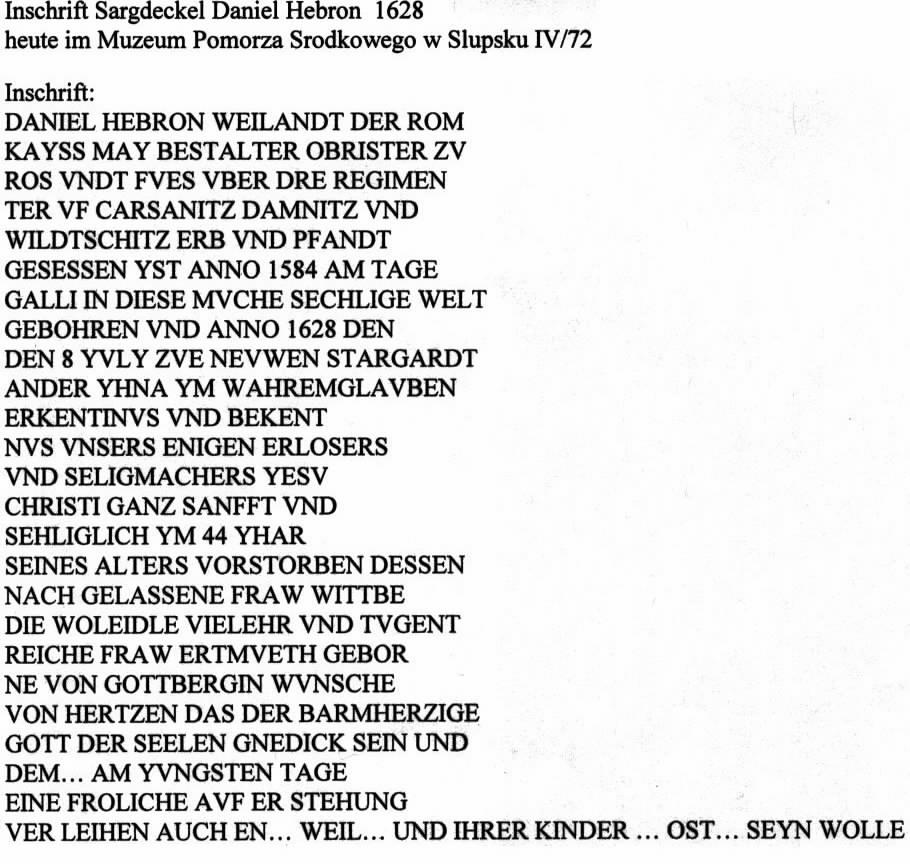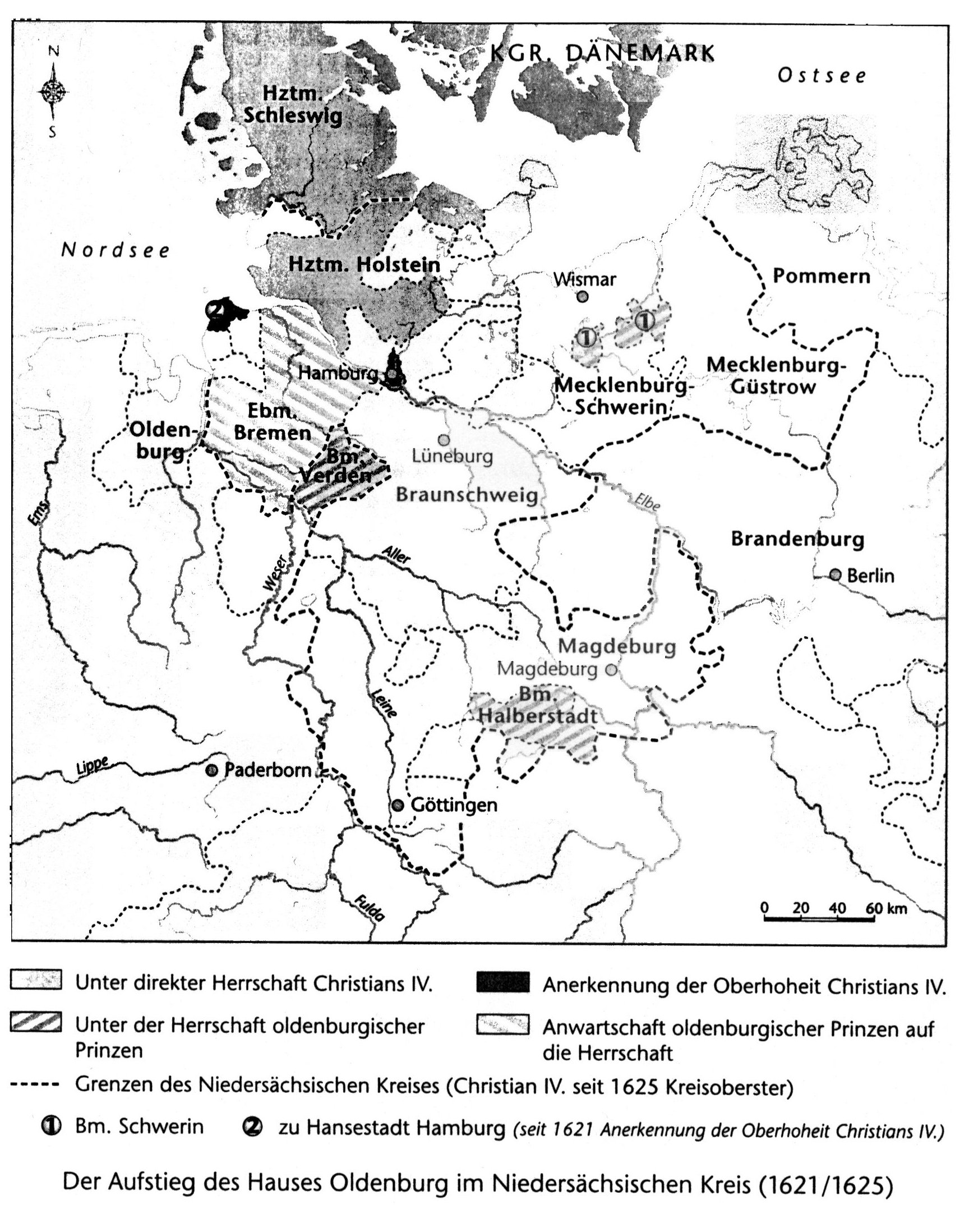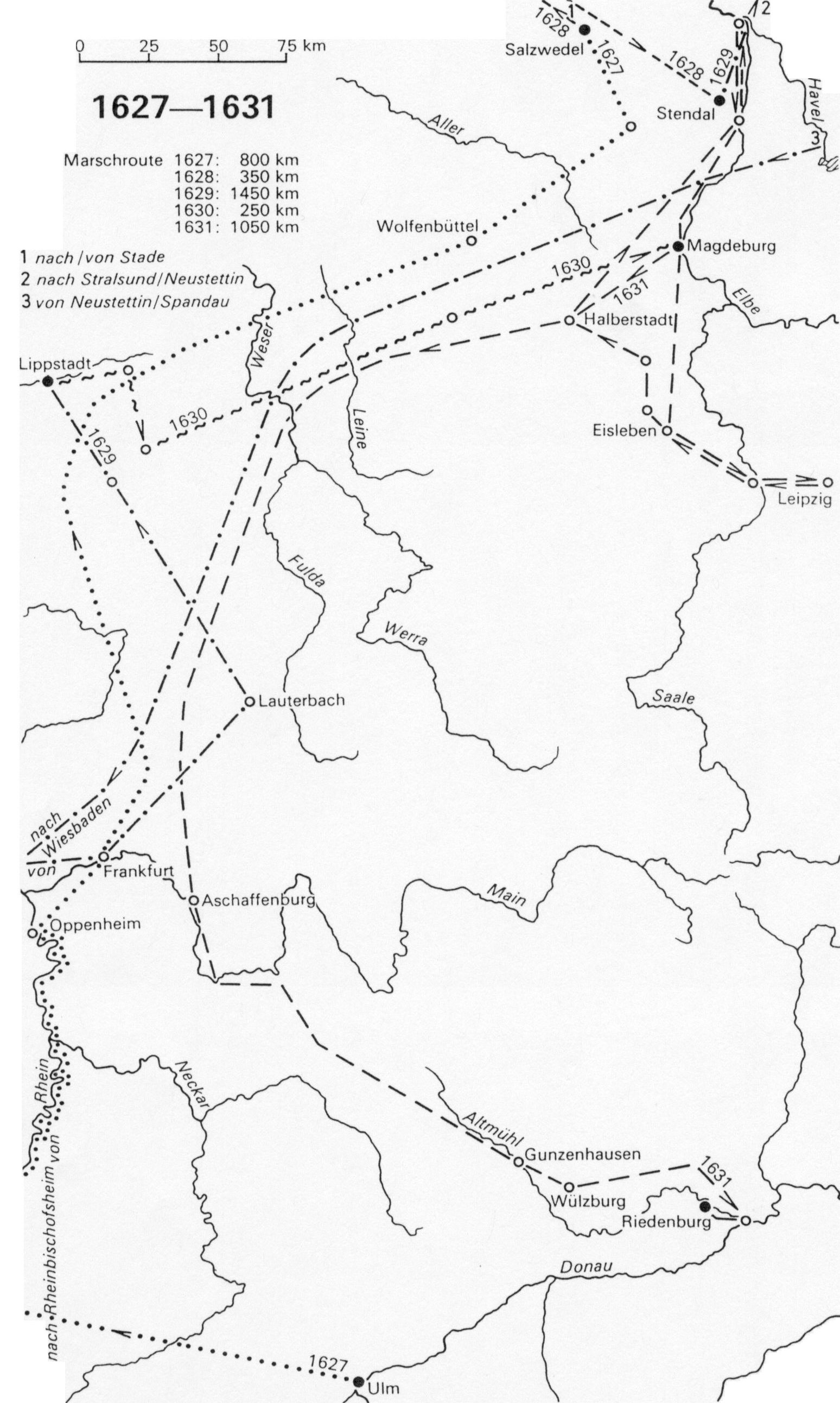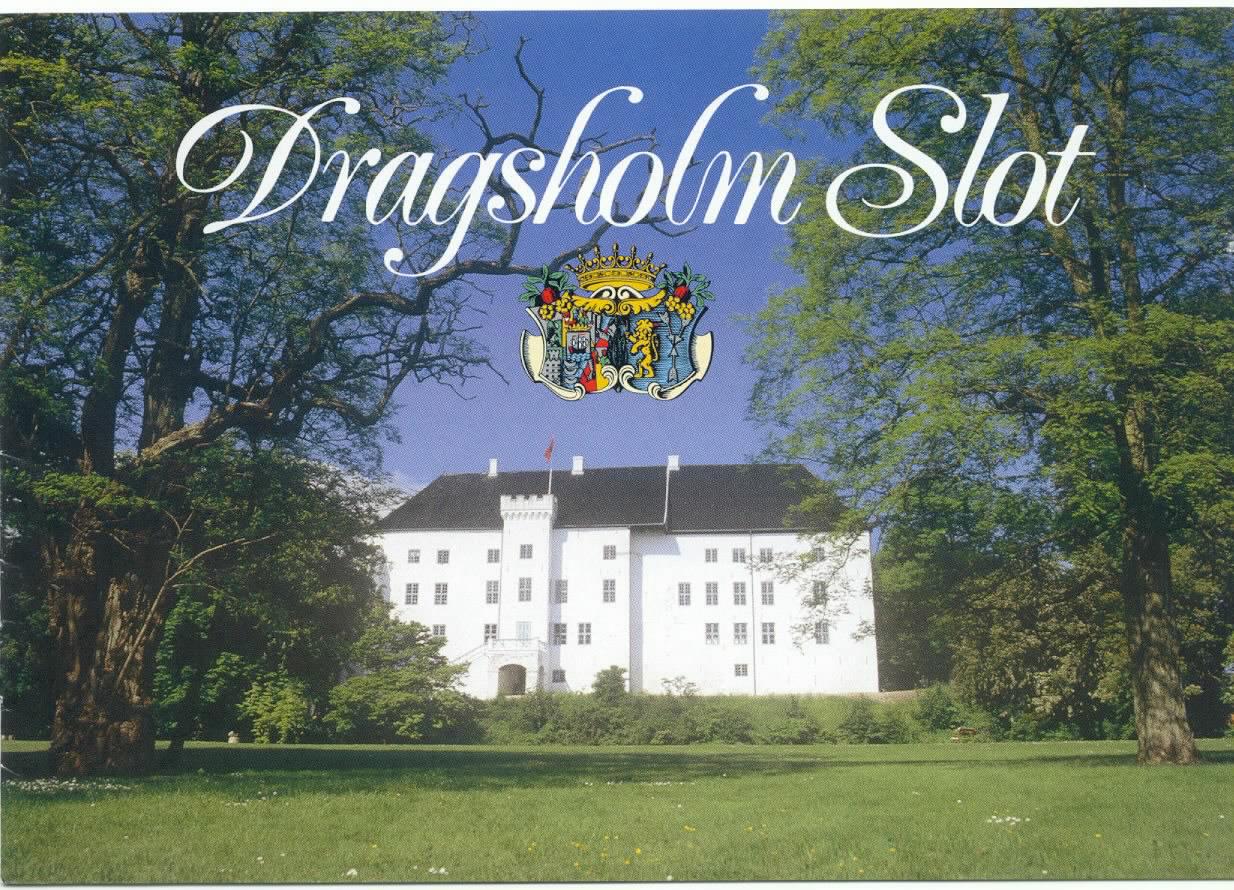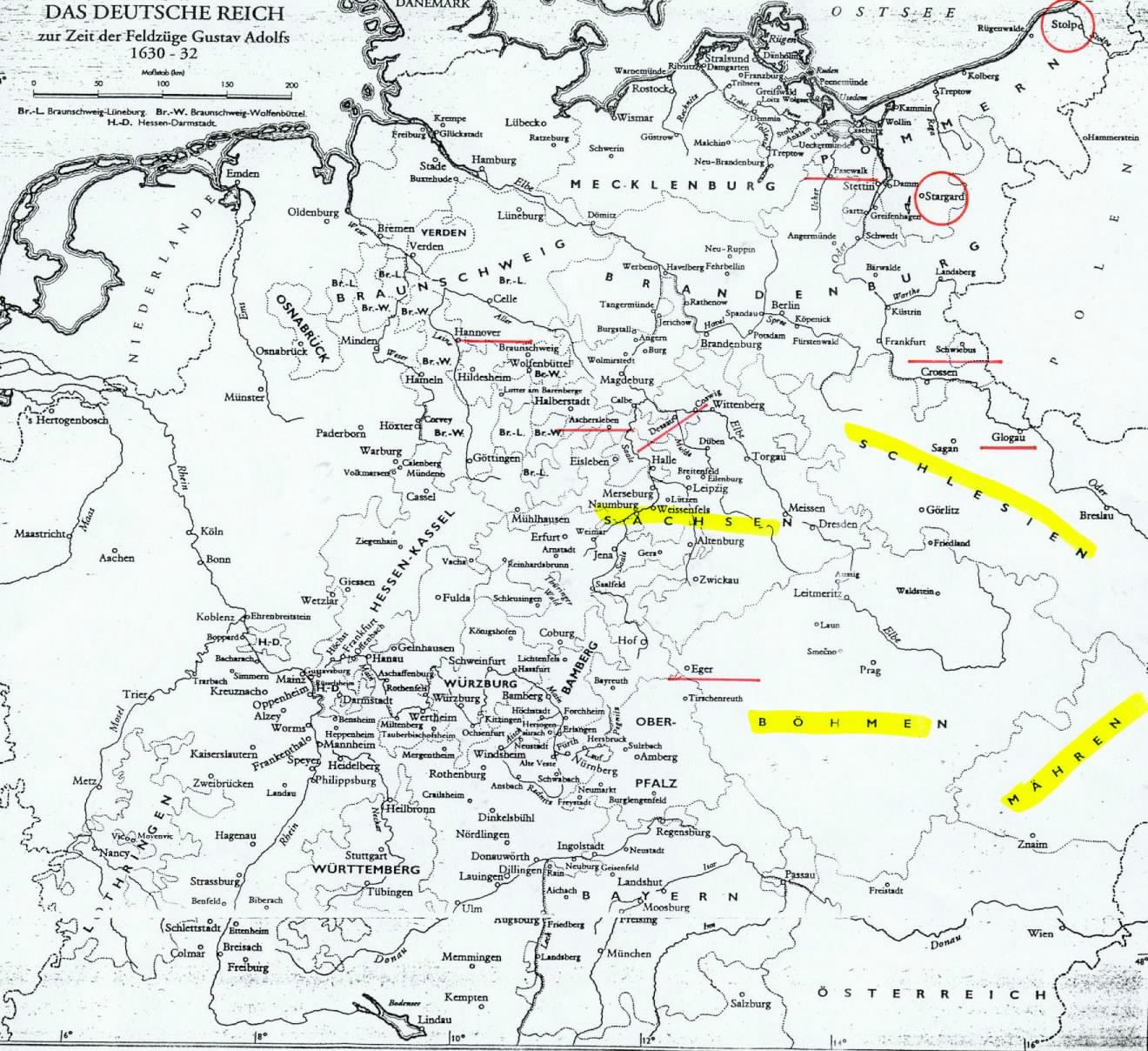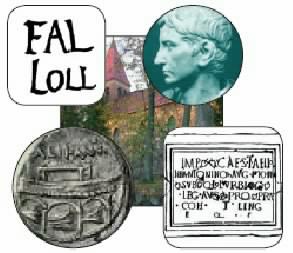
LOLL
Hebron/Hepburn/Bothwell
Einleitung
Wer war Daniel Hebron 1584-1628 ?
Heute geht man davon aus, dass ein Personen-Name einen Menschen
eindeutig identifiziert. Selbst bei hochrangigen Militärs war dies
im MA noch nicht der Fall. Den Personen-Namen Hepburn und den
Ortsnamen Hebron gibt es schon sehr lange. Dies hat dazu geführt,
dass bei historischen Aufzeichnungen für unterschiedliche
Zeitabschnitte, Verwechselungen immer wieder vorkommen. Im
Dreißigjährigen Krieg gab es zwei verschiedene Heerführer
(Obristen) mit Namen Hepburn (Hebron), einmal den kaiserlichen
(Ferdinand II) Obersten Daniel Hebron und den königl.-schwedischen
(Gustav II. Adolf) Obristen, später französischen Maréchal de
France (Feldmarschall) Sir John Hepburn.
Bis vor kurzem bin ich davon ausgegangen, dass es im 17. Jh. nur
einen Oberst Hebron/ Hepburn gab. Gemeint war der mir bekannte
Oberst Daniel Hebron, von dem es im Museum in Stolp den
Zinnsargdeckel aus seinem Grab in Sageritz Kreis Stolp/POM. (heute
Zagorzyca) gibt, auf dem auch seine Geburts- und Sterbedaten
stehen.
In einem Erfahrungsaustausch mit Schottischen Familienforschern
sind vor einiger Zeit dann Zweifel aufgekommen, an der
Stammfolgebeschreibung im SEDINA-ARCHIV Nr. 4/197 und ob es nur
einen Oberst Daniel Hebron/Hepburn gibt. Es werden diesem im
besonderen Schottische Quellen entgegengestellt, u.a. die Bücher
von Th. A. Fischer " Scots in Germany" und "The Scots in Eastern
an Western Prussia" im Kapt. The Army S.89. Demnach fiel dieser
Hepburn in einer Schlacht im Nahkampf bei Savernes und Zabern
1636. Als Quelle wird hier ein Brief von Richelieu an La Valette
vom 20. Juli 1636 angegeben.
Jetzt konnten Dank der Forschungsarbeiten von Herrn Peter
Engerisser diese Verwechselungen richtig gestellt werden. Er hat
das Buch geschrieben "Der Dreißigjährige Krieg in Schwaben,
Franken und der Oberpfalz 1631 - 1635". Herr Engerisser hat
dankenswerterweise neben seinem Buch weitere Ergebnisse seiner
Recherchen zur Verfügung gestellt. Die übermittelten Daten und
Quellen darf ich hierzu benutzen. Danach gab es die oben genannten
Heerführer Oberst Daniel Hebron bei Wallenstein und Oberst Sir
John Hepburn bei Gustav II. Adolf.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Hebron in Stargard, Sageritz und Damnitz
Daniel Hebron im Dreißigjährigen Krieg
Das Phänomen Wallenstein
Grablegung im beschaulichen Sageritz
Kriegsnöte der pommerschen Stadt Stolp
Kompanien und Regimenter die Daniel Hebron geführt hat nach
einer Detaillbeschreibung von Herrn Engerisser
Daniel Hebron militärischer Subunternehmer bei Wallenstein
Briefwechsel Daniel Hebron/Wallenstein/Tilly
Der Niedersächsich-dänische Krieg von 1623 - 1630
Parallelen aus einem Söldnerleben (Stralsund, Neustettin,
Stargard, Stolpmünde, Sageritz)
Stiftung und Legate im Landesarchiv Greifswald
Die Grafen von Bothwell
Die Familie des Oberst Daniel Hebron
Kurzbiographien über den Obristen des Dreißigjährigen Krieges
Sir John Hepburn
Sir John Hepburn stirbt in der Schlacht bei Savernes und Zabern
Zusammenfassung
Literaturliste
Hebron in Stargard, Sageritz und Damnitz
Vor dieser Kirche ist das Grab von Daniel Hebron.Auf dem Grab
befand sich die Dorflinde. Dies ist heute der Dorfplatz und
Mittelpunkt des Dorfes.
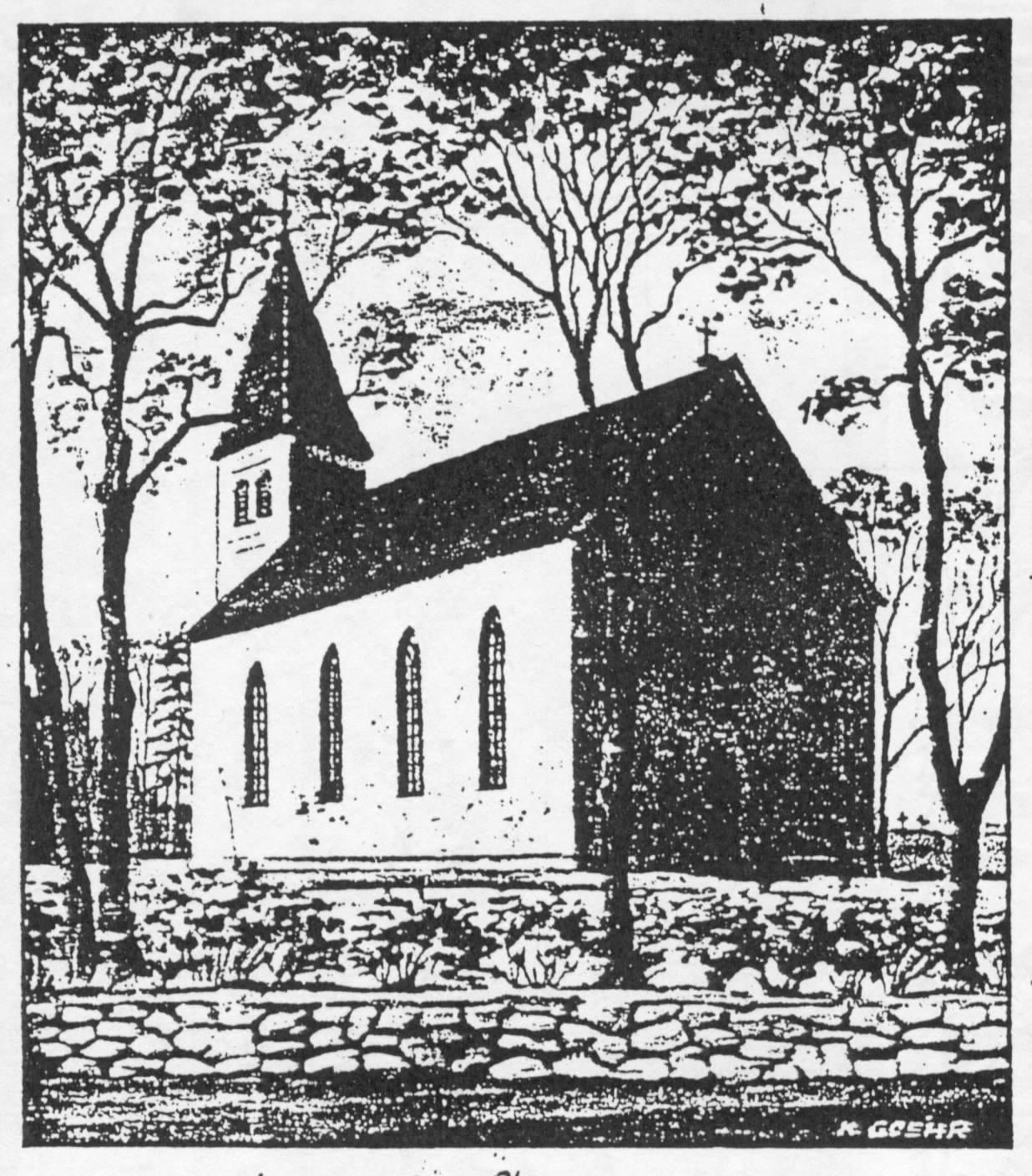 |
Dies ist die Sageritzer Kirche nach
einer Zeichnung von K. Goehr. Das Bild dieser z.T. aus
großen Granitblöcken erbauten Steinkirche
entspricht im groben noch dem heutigen Aussehen.
Im 17. Jhd war dies aber nur eine kleinere Holzkirche.
|
Als Kind bin ich oft in diesen Baum - die Dorflinde -
geklettert, weil man von hier sehr gut und weit ins Oberdorf und
ins Unterdorf blicken konnte. Es gibt ein Foto bei mir mit der
Dorflinde das ich 1978 in Sageritz gemacht habe, wo die letzte
Dorflinde noch zu sehen ist. Heute steht diese Linde nicht mehr,
es gibt aber Pläne der Gmyna Damnica eine Nachfolgelinde zu
pflanzen. Oberst Daniel Hebron wurde 1628 im Dorf Sageritz Kreis
Stolp/Pommern mit allen militärischen Ehren beigesetzt. Der noch
andauernde Dreißigjährige Krieg hat verhindert dass sein Grab
unmittelbar zum Ehrenmal wurde. Die Wirren dieser Zeit ab Mitte
1628 beschreibt im Detail Dr. R. Schuppius in seinem Beitrag
Stolp von 1600-1650" in Beiträge zur Heimatkunde
Hinterpommerns Nr. 5" Das Aussterben der Hebrons in Pommern im
18. Jh. (der letzte ist Johann Dietrich Freiherr von Hebron
*1705 + 1756 in Viteröse bei Groß-Jannowitz Kr. Lauenburg) hat
dazu beigetragen, dass auch er zunächst in Vergessenheit geraten
ist. Alle Bauern, auch die Bauern in Sageritz waren im
Dreißigjährige Krieg so ausgeplündert worden, dass sie nicht im
Traum daran dachten dem Oberst Daniel Hebron für seine
historische Teilnahme ein Denkmal zu setzten. Die späteren
Bürgermeister der Kirchspiel-Gemeinde Sageritz hatten ebenfalls
nicht die Möglichkeit sich forschend mit der Geschichte ihrer
Heimat auseinanderzusetzen und mit den Kenntnissen z.B. eines
Cosmus von Simmern, ihm ein bewahrendes Andenken, in ihrer
Gemeinde zu setzen. Ausgelöst durch die Geschichte über den
heute historischen Sargdeckel des Oberst Hebron von 1628, der
beim Torfstechen im Moor zwischen Sageritz und Mahnwitz gefunden
wurde, ergibt sich die Möglichkeit der nachträglichen
Ehrerbietung und den historischen Ort Sageritz, an dem er
bestattet wurde in die Analen aufzunehmen. Selbst der kleine
Ausschnitt (im Foto der Abb.2 zu sehen) zeigt die Pracht der
Bestattung seiner Zeit. Kreis Stolp hat u.a. auch zu den
Untersuchungen um das in Sageritz befindliche Grab des Oberst
Daniel Hebron geführt. Oberst Daniel Hebron *16.10.1584 in
Stargard + 08.07.1628 in Stargard, beigesetzt 1628 unter der
Linde des Dorfplatzes in Sageritz (Sageritz war das Kirchspiel
Dorf für die Güter Carstnitz, Benzin und Damnitz, die der
Familie Hebron gehörten).
<
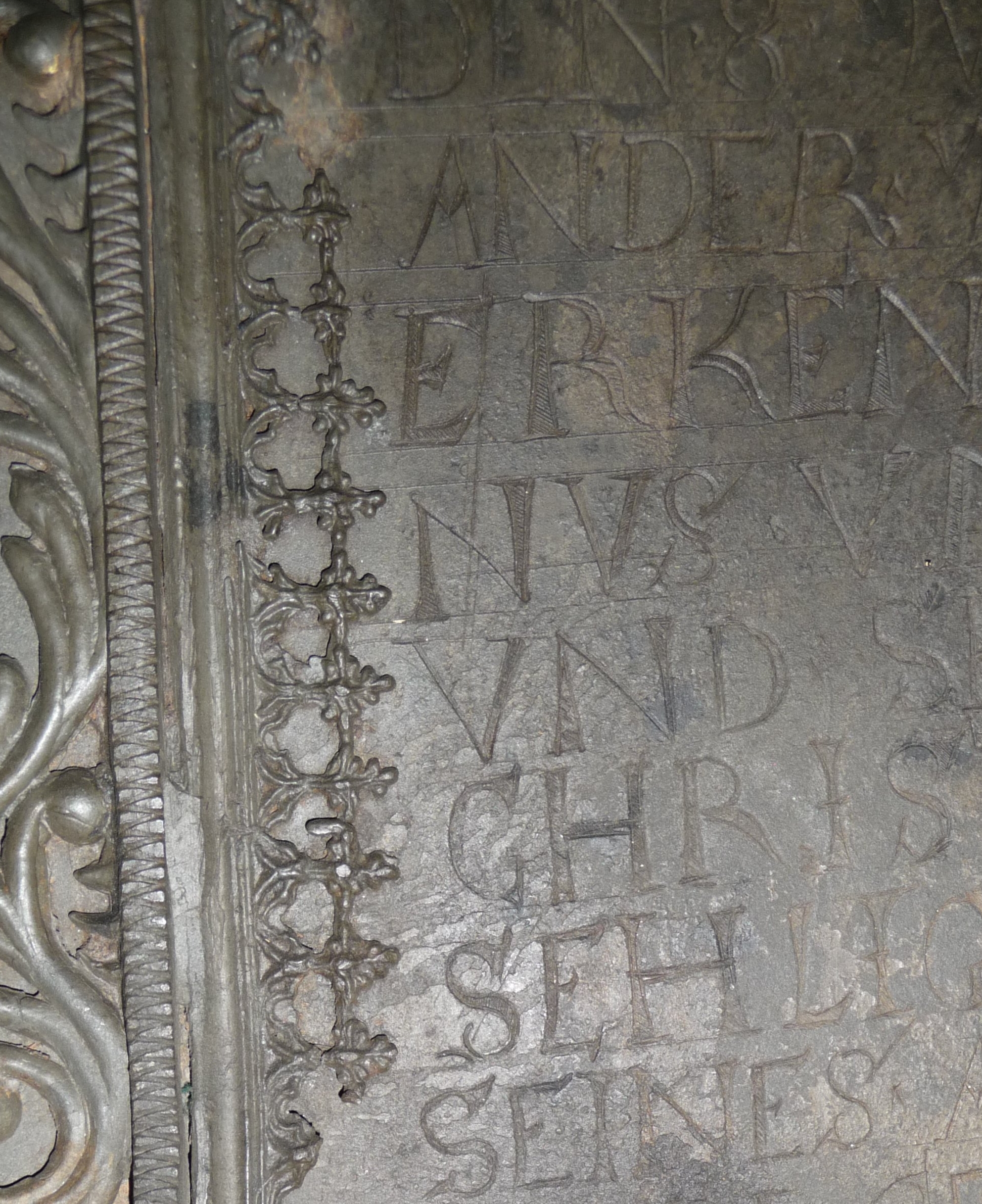 |
Oben das Foto der Teilansicht der Inschrift auf der Grabplatte.
Hier folgt der Text auf dem Sargdeckel Daniel Hebron +
08.07.1628:
Eine weitere Quelle findet sich in der Literatur. Chronik" heißt
das 14 bzw. 18 bändige Werk des Cosmus von Simmern. Er lebte von
1581 bis 1650, stammt aus Kolberg und berichtet über Daniel Hebron
aus eigenem Erleben. Dieses Werk wird in den Baltischen Studien in
mehreren Aufsätzen beschrieben. Dr. Rud. Hanncke, Cöslin berichtet
von dem Studium der Abschriften der Chronik. In Baltischen
Studien" 40. Jahrgang darüber und was von Simmern über Hepburn
sagt. Danach ist Hepburn am 8.July 1628 in seinem Geburtshaus in
Stargard/Pommern an einer Krankheit gestorben.
Daniel Hebron im Dreißigjährigen Krieg
Daniel Hebron starb bereits 1628 mitten im Dreißigjährigen Krieg
und doch gehören alle Jahre des Dreißigjährigen Krieges dazu, wenn
man sein Leben und seinen Anteil an diesem Krieg beschreiben will.
Die Lebensumstände des 1584 geborenen Daniel Hebron als Sohn eines
Schottischen Adligen und einer Deutschen Mutter die aus dem
Pommerschen Landadel stammte wurde er in Stargard in Hinterpommern
geboren. Aus diesem Elternhaus und seinem Umfeld wurde er zum
Kriegsunternehmer des Dreißigjährigen Krieges. Für Hebron war es
kein Religionskrieg. Eigentlich war mit dem Augsburger
Religionsfrieden von 1555 der 1. Zeitabschnitt der Reformation
abgeschlossen. Bestimmte politische und konfessionelle Probleme
waren hier gelöst worden. Nach dem Ausbruch dieses Krieges im
Jahre 1618 trat Daniel Hebron als Kriegsunternehmer dieses Krieges
auf. Einiges aus dieser Zeit ist gut dokumentiert, weil er lange
Zeit mit seinen Regimentern bei Albrecht von Wallenstein war.
Das Phänomen Wallenstein
Als Edelmann erbot sich Wallenstein eine eigene Armee für Kaiser
Ferdinand aufzustellen, so schreibt Prof. Dr. Ernst Walter Zeeden
in Das Zeitalter der Glaubenskämpfe 1555-1648 um dann im Kap. 10,
Dänischer Krieg und Friede von Lübeck eine für mich prägnante
Kurzbeschreibung zu formulieren. Er war ein Gemisch von genialem
Organisator, Geschäftsmann und skrupellosem Beutemacher. Besondere
Merkmale dieses Krieges sind die Brutalität, die Gesetzlosigkeit
und die Seuchen. Johannes Arndt beschreibt im Kapitel Die
Perspektive der Zivilbevölkerung" die Auswirkungen des Krieges auf
Wirtschaft und Gesellschaft. In diesem Buch Der Dreißigjährige
Krieg 1618-1648 leitet er das Kapitel wie folgt ein: Der
Dreißigjährige Krieg ist als schlimmste von Menschen verursachte
Katastrophe vor dem zweiten Weltkrieg ins kollektive Bewusstsein
der Mitteleuropäer eingegangen. Der Große Krieg", so hieß er, bis
er das Attribut an den Ersten Weltkrieg abtreten musste.
Grablegung im beschaulichen Sageritz
Für die chaotischen Verhältnisse des Dreißigjährigen Krieges war
das Dorf Sageritz ein beschaulicher Ort. Heute weiß man, wenn man
das Muzeum Pomorza Srodkowego w Sluspku besucht, wie der Sarg des
Obristen Daniel Hebron 1628 ausgesehen hat. Ein gut erhaltener
Zinnsarg (Sarkophag) der Prinzessin von Sachsen-Lauenburg,
Katherine Ursula aus derselben Zeit 1580 bis 1611 und die
Fragmente des Sargdeckels von Hebron lassen einen Vergleich
absolut zu. Wenn man Fotos der Zinnguss Gravierung nebeneinander
hält, könnte man meinen beide Särge stammen aus derselben
Werkstatt. Hebron selber kannte die damalige Holzkirche und die um
die Kirche liegenden Grabplätze. Schon sein Vater Alexander Hebron
hatte 1617 die damaligen Güter Damnitz, Benzin und Carstnitz
gekauft. Er hat also wohl diesen Grabplatz selber ausgesucht. Erst
1631 kauft die Witwe Erdmuth von Hebron das Gut Sageritz, das aber
schon Kirchspieldorf der Propstei Stolp ist (Werner von Schulmann,
Veröffentlichungen der historischen Kommission für Pommern). Das
das Grab später ausgeraubt und sogar versucht wurde den Sargdeckel
zu stehlen, lässt darauf schließen, dass es eine prunkvolle
Bestattung mit wertvollen Grabbeigaben gewesen sein muss. Vom
Reichtum des Daniel Hebron und seiner Familie zeugt auch die
Stiftung die er bei der Stadt Stolp in Form Legaten hinterließ.
Kriegsnöte der pommerschen Stadt Stolp
Ein eigenes Kapitel befasst sich mit den Aufzeichnungen von Dr.
R. Schuppius, weil er in dem Beitrag Nr. 5 zur Heimatkunde
Hinterpommerns, veröffentlicht durch die Gesellschaft für
Pommersche Geschichte und Altertumskunde, sowohl die Zeit von 1600
bis 1650, als auch den örtlichen Bezug zur Stadt Stolp und dem
Landkreis Stolp beschreibt. Für die hier enthaltenen Angaben zu
Daniel Hebron sind bedeutsam die Ereignisse in 1627 und 1628.
Pommern mit seinen Herzögen Bogislaw XIII. und Bogislaw XIV.
haben, während schon in anderen Teilen Deutschlands der
Dreißigjährigen Krieg tobte, durch eine Neutralitätspolitik
Pommern aus dem Krieg herauszuhalten. So ist auch das im November
1627 geschlossene Abkommen von Franzburg zu erklären, wo Bogislaw
XIV. dem Kaiser das Recht einräumte, zum Schutz gegen eine
Schwedische Invasion seine Truppen in Pommern zu stationieren. So
begann durch diese Stationierung das Auspressen der Stolper
Bevölkerung mit dem Prinzip der Kontribution durch die eigentlich
verbündeten Truppen Wallensteins. Für die Zeit des März 1628
schreibt Schuppius u.a. Oberstleutnant von Wettberg machte aber
Schwierigkeiten und trat mit neuen Geldforderungen an das Quartier
heran, sodass der Oberkommandierende (der Truppen Wallensteins)
Oberst Daniel v.Hebron eingreifen musste. An anderer Stelle
beschreibt Schuppius, wie auch Hebron selbst Forderungen für sich
und seine Truppen an die Stadt Stolp und deren Bevölkerung stellt
...und außerdem gab Hebron bekannt, dass er für sich als
Exhibitionsgeld" monatlich 875 Thlr beanspruche . . .. In die Zeit
Juni/Juli 1628 datiert auch Schuppius sein versterben. Er nennt
hier Oberstleutnant Hans Rudolf v.Bindtauff als seinen Nachfolger
im Amt des Oberkommandierenden östlich der Oder.
Kompanien und Regimenter die Daniel Hebron geführt hat nach
einer Detailbeschreibung von Herrn Engerisser
Über Daniel Hebron als kaiserlicher Kriegsoberst ist aufgrund
seiner kurzen Tätigkeit von 1625 bis 1628 in den einschlägigen
Quellen nicht viel verzeichnet. Die Quelle LKKA bezeichnet
übrigens die "Lista Kaiserischer Kriegs Armada", also die
offiziellen Regimentslisten der kaiserlichen Armee, abgedruckt in
den "Documenta Bohemica Bellum Tricennale Illustrantia" (abgk.
DBBTI, herausgegeben von der Academia Nakladateltvi
Ceskoslovenske, hrsg. von Miroslav Toegel, Josef Kollmann,
Vladimir Budil, Josef Polisensky u. a., 7 Bände, Prag 1971-1981).
Der einzige Band, der Daniel Hebron führt ist Band IV, der den
Zeitraum 1625 - 1630 abdeckt (Prag, 1974). Danach führte Daniel
Hebron ab 1625 verschiedene Regimenter Deutscher Arkebusiere und
Dragoner, die wie folgt stationiert waren: Im Jahr 1625: 4
Kompanien deutsche Arkebusiere, disloziert (stationiert) in
Böhmen. und 10 Kompanien deutsche Dragoner, disloziert in Böhmen
im Jahr 1626: 8 Kompanien deutsche Arkebusiere, disloziert im
Reich 10 Kompanien deutsche Dragoner, disloziert in Schlesien im
Jahr 1627: 10 Kompanien deutsche Arkebusiere, disloziert im
Schlesien 10 Kompanien deutsche Dragoner, disloziert in Polen im
Jahr 1628: 10 Kompanien niederdeutsche Knechte (Fußvolk),
disloziert in Mecklenburg. Die Regimenter Arkebusiere und Dragoner
sind im Jahr 1628 bereits nicht mehr gelistet.
Daniel Hebron militärischer Subunternehmer bei Wallenstein
Wallenstein (Albrecht von Wallenstein 1583-1634) hat viele
Namen, Ernst Walter Zeeden beschreibt ihn im Gebhardt Bd.9, Das
Zeitalter der Glaubenskämpfe als ein Gemisch von genialem
Organisator, Geschäftsmann und skrupellosem Beutemacher". Sein
System der Kontribution in der Bezahlung der Kriege führte zur
Erpressung und Ausbeutung der Bevölkerung und machte ihn zu einem
reichen Mann. Zu diesem System gehörte auch dass die
Heeresaufbringung nicht nur die Anwerbung und Aushebung eigener
Streitkräfte umfasste sondern auch Verträge mit militärischen
Subunternehmern. Einer seiner Subunternehmer war Oberst Daniel
Hebron (Hepburn) mit mehreren eigenen Regimentern. Peter
Engerisser beschreibt in seinem Buch, Teil II: Kriegswesen, Sitten
und Gebräuche der kaiserlich-ligistischen und
schwedisch-Protestantischen Armeen, Kapitel Heeresformationen und
- Organisationen, wie die Regimenter zu Fuß und zu Ross aussahen.
Das Kaiserliche Regiment Fußvolk hatte zwischen 1620 und 1636 etwa
600 bis 1235 Mann.
Briefwechsel Daniel Hebron/Wallenstein/Tilly
Am 2. Sept. 1625 schreibt Wallenstein an Tilly, dass er nun von
Eger gegen Mansfeld im Niedersächsischen aufbreche, einzig das
Regiment (Daniel) Hebron bleibe noch in Böhmen liegen (Bd. IV, S.
60). A. 14. April 1626 schreibt Wallenstein aus Aschersleben, er
hätte den Obristen Hebron nach Neu-Haldensleben kommandiert, um
den Truppen des Christian von Braunschweig Abbruch zu tun (Bd. IV,
S. 110). Am 13. August 1626 befinden sich die Regimenter Hebrons
bei der Verfolgung Ernst von Mansfelds bei Groß-Glogau und Oppeln
in Schlesien (Bd. IV, S. 139). Am 3. März 1627 dankt Herzog
Bogislav von Pommern (aus Stettin) dem Obristen Daniel Hebron für
die angebotene Hilfe gegen das schwedische Heer, welches zwischen
Pasewalk und Prenzlau eingedrungen wäre und sich nun an der Grenze
der Neumark und Pommerns formiere. (Bd. IV, S. 182). Am 16. März
1627 schreibt Oberst Hebron aus Lubben an Wallenstein: Das
schwedische Heer, das aus Mecklenburg anrücke, habe an zwei
Stellen nach Pommern durchbrechen wollen, sei aber
zurückgeschlagen worden. Jetzt ziehe es angeblich gegen
Frankfurt/Oder. Er habe Herzog Bogislaw v. Pommern und den General
in Posen schriftlich gewarnt, vor dem Feind auf der Hut zu sein,
und ihm keinen Durchzug zu gestatten und ihm für den Bedarfsfall
eine Hilfstruppe von 6000 Mann [!] angeboten. (Bd. IV, S. 185). Am
5. August 1627 schreibt Oberst Daniel Hebron aus Schwiebus an
Wallenstein, er habe zu Herzog Bogislaw von Pommern einen
Trompeter mit der Aufforderung gesandt, er möge die Grenzen seines
Landes schützen, da der Feind sich dorthin wende. Dieser Trompeter
habe die Nachricht gebracht, dass es zwischen Berlinchen und
Bernstein zu einem Treffen (Gefecht) zwischen beiden Armeen kam,
bei welchem (der Kais. Oberst) Pechmann gefallen, Schaffgotsch
(Hans Ulrich Frh. von, Kais. Oberst, später Generalwachtm.)
verwundet und seinem (Hebrons) Regiment Verluste zugefügt worden
seien. Trotzdem hätten die Kaiserlichen gesiegt und den Feind in
die Flucht geschlagen. Damit enden die Briefwechsel Hebrons an
Wallenstein. Mitte 1628 berichtet die Kriegsliste, dass das
Fußregiment Hebron an den Herrn Franciscus von Marazan, mit
gleichzeitiger Bestallung zum Obristen, übergeben wurde. Hepburn
war hier wohl schon erkrankt und nicht mehr in der Lage das Rgt.
zu führen. " Vor seinem Tod hat er das Commando Obrist-Lieut.
Bruder Richarten von Magdeburg" übergeben. (Briefwechseln aus
DBBTI Bd. IV über Peter Engerisser)
Der Niedersächsich-dänische Krieg von 1623 - 1630
Daniel Hebron starb am 08. Juli 1628. Ein großer Teil seiner
aktiven Teilnahme im Dreißigjährigen Krieg liegt also im
Niedersächsich-dänische Krieg von 1623 - 1630. Christoph Kampmann
widmet in seinem Buch Europa und das Reich im Dreißigjährigen
Krieg, Stuttgart 2008 im Kapitel IV. Europäische Eskalation I mit
dem Titel" Der Niedersächsich-dänische Krieg von 1623 - 1630
einen ganzen Abschnitt. Hebron war mit seinen Truppen 1625 in
Böhmen 1626 im Reich ( 8 Kompanien) in Schlesien (10 Kompanien)
1627 in Schlesien (10 Kompanien Arkebusier) in Polen ( 10
Kompanien Dragoner) 1628 in Mecklenburg (10 Kompanien Fußtruppen,
Niederdeutsche) Aus diesem Buch habe ich auch die nachfolgende
Karte (s. Abb. 4) entnommen, die die Gebiete der Kriegsparteien
Niedersachsen und Dänemark zeigt.
Abb. 4 Landkarte zum Niederländisch-dänischen Krieg 1623-1630
Karte S. 52 aus Kampmann
Parallelen aus einem Söldnerleben (Stralsund, Neustettin,
Stargard, Stolpmünde, Sageritz)
Kaschubien (gemeint ist Hinterpommern) ist gar ein wildes Land,
hat aber eine treffliche Viehzucht und allerlei verschiedene
Tiere. Ab hier wollten wir (die Söldner) kein Rindfleisch mehr
essen, sondern nur noch Gänse, Enten und Hühner." Dies schreibt
ein Söldner in der Truppe von Wallenstein aus dem eigenen Erleben
im Dreißigjährigen Krieg aus der Zeit 1627-1631, also in der Zeit,
in der Oberst Daniel Hebron seine Regimenter für Wallenstein
eingesetzt hat, aber auch schon in der Zeit in der er in Stargard
starb und sich in einem Dorf im Kreis Stolp begraben ließ. Die
Marschroutenkarte dieses Söldners wird auf der nachfolgenden Karte
(Abb. 5) beschrieben
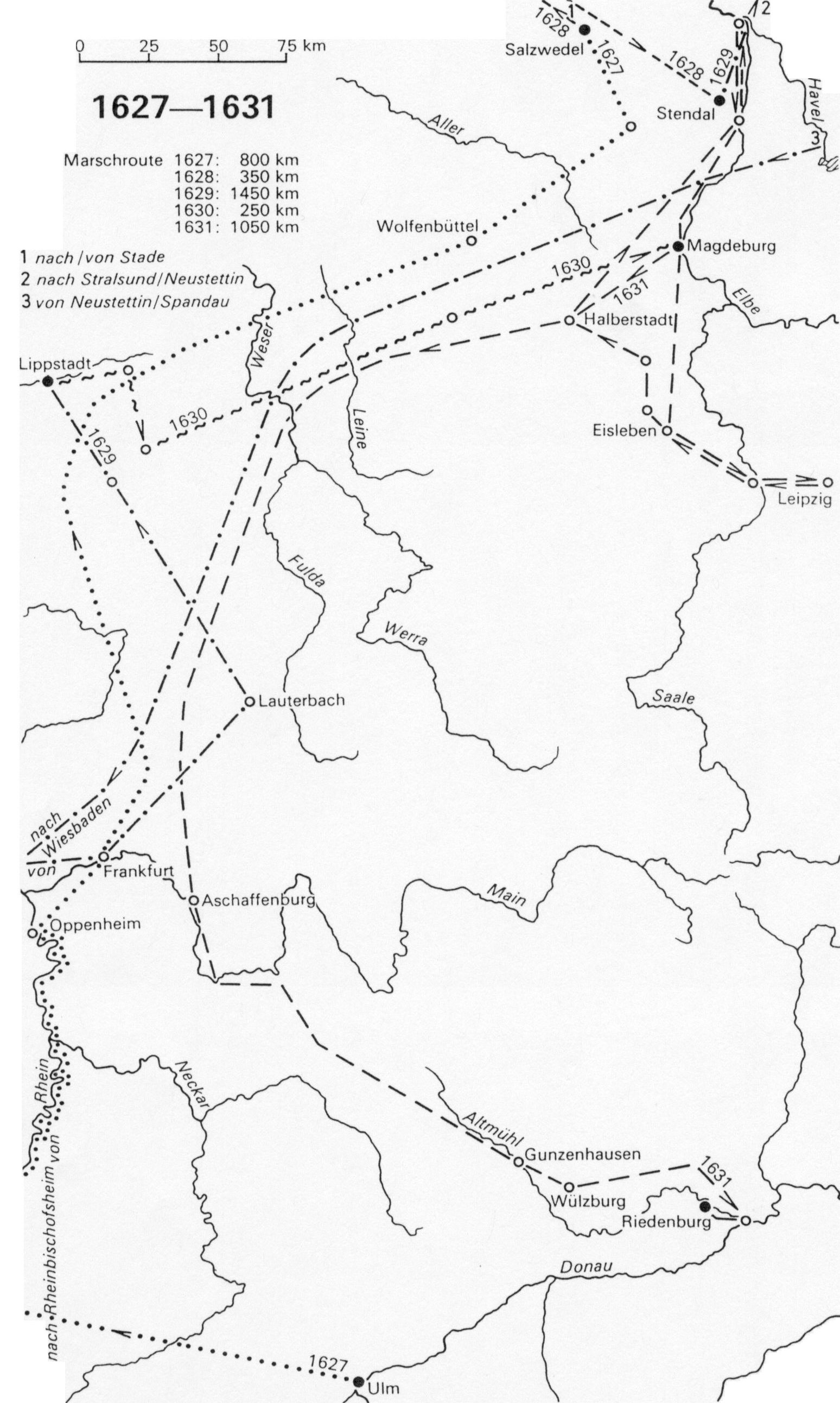 |
Abb. 5 Karte 1627-1631 S. 44 Jan Peters - von Stade nach
Stralsund, - von Stralsund mit 2 Schiffen nach Kaschubien
(möglicherweise über die Ostsee bis Stolpmünde nach Neustettin) -
von Neustettin nach Spandau Diese Marschroutenkarte auf Seite 44
des Erfahrungsberichtes aus Ein Söldnerleben im Dreißigjährigen
Krieg" In den Anmerkungen zu dieser Passage zu dem Kapitel
Bericht/Originalfassung heißt es, Kaschuben: Land der wendischen
Bevölkerung von Pomerellen, Westpreußen, Hinterpommern.
Stiftung und Legate im Landesarchiv Greifswald
Das Landesarchiv in Greifwald bewahrt Akten der Stadt Stolp auf.
Im Archivbestand befinden sich unter der Rep. 38b auch
Stiftungsunterlagen aus dem Nachlas von Daniel Hebron. Die Stadt
Stolp als Treuhänder archivierte die Briefe zur Bewilligung von
Legaten aus dieser Stiftung aus den Jahren 1650 -1747. Titel im
Archiv sind u.a. die Positionen (Rep. 38b) 361 bis 367. Bereits
1628 gründete Oberst Daniel Hebron die Stiftung zur Förderung
strebsamer und begabter Jünglinge mit einem Kapital von 21.081,36
Mark. Diese Legate sollten jährlich an zwei adelige und zwei
bürgerliche junge Männer gehen, die vom Magistrat der Stadt Stolp
ausgesucht werden sollten. Zu dieser Zeit gab Hebron auch die
Spende an die Stolper Marienkirche (Bartholdy).
Die Grafen von Bothwell
Diese Familie der Hepburns (Daniel von Hepburn) stammt vom heute
verfallenen Adelssitz Bothwell-Castle in Schottland. Das
nachstehende Foto zeigt die heute noch vorhandenen Reste des
Bothwell Castle.
Abb. 6 Kopie eines Fotos der Ruine Bothwell in Schottland
Alexander Hepburn, der Vater von Daniel Hepburn kam im 16 Jh.
von hier nach Pommern. Der in der Geschichte bedeutendste Hepburn
war James Hepburn, Earl James Bothwell, Herzog von Orkney. Er war
der 4. Earl auf Bothwell und Großadmiral von Schottland. Durch
seinen Ehrgeiz erreichte er sogar die Heirat mit Maria Stuart. Als
Earl James Bothwell, Herzog von Orkney (Jacob Heburnus Bothweliae
comes) heiratete er am 15.05.1567 Maria Stuart. Später geriet
James Hepburn zwischen die Fronten der beiden damals herrschenden
Parteien in Schottland. Auf der einen Seite der mehrheitliche
protestantische (Calvinistisch) Adel und Clerus und auf der
anderen Seite das katholische Königshaus von Maria Stuart. Die
Gießener Studien von 1881 zur Untersuchung der Regierung von
Königin Maria Stuart von Schottland beschreiben auch den Anteil
des Grafen Bothwell an der Geschichte dieser Zeit. Th. A. Fischer
zitiert in The Scots in Eastern and Western Prussia" auf S.87
hierzu ein Empfehlungsbrief (hier datiert auf 1566) von Queen Mary
und Henry Darnley für einen David Melville. Darnley wurde 1567
angeblich durch den nachfolgenden Ehemann von Maria, James Hepburn
ermordet. Richtig ist nur, dass er einem Komplott zur Ermordung
des Königs angehörte und das seine Leute das Haus des Königs in
Edinburgh in die Luft sprengten. James Hepburn (Bothwell) musste
nach den Intrigen des Schottischen Adels fliehen. Obwohl er vom
Mordvorwurf freigesprochen wurde, nahm ihn der Dänische König
Frederik II gefangen und benutzte ihn als politisches Faustpfand.
Nach 11 Jahren Kerkerhaft auf Schloss Dragsholm starb er dort am
14. April 1578. Der Sarg von James Hepburn steht in der Krypta der
Kirche von Faarevejie in Dänemark. Es gibt von meinem Besuch
dieser historischen Stätten im Jahre 2005 noch mehrere nicht
veröffentlichte Fotos. Auch sein Bruder musste fliehen und kam so
nach Hinterpommern.
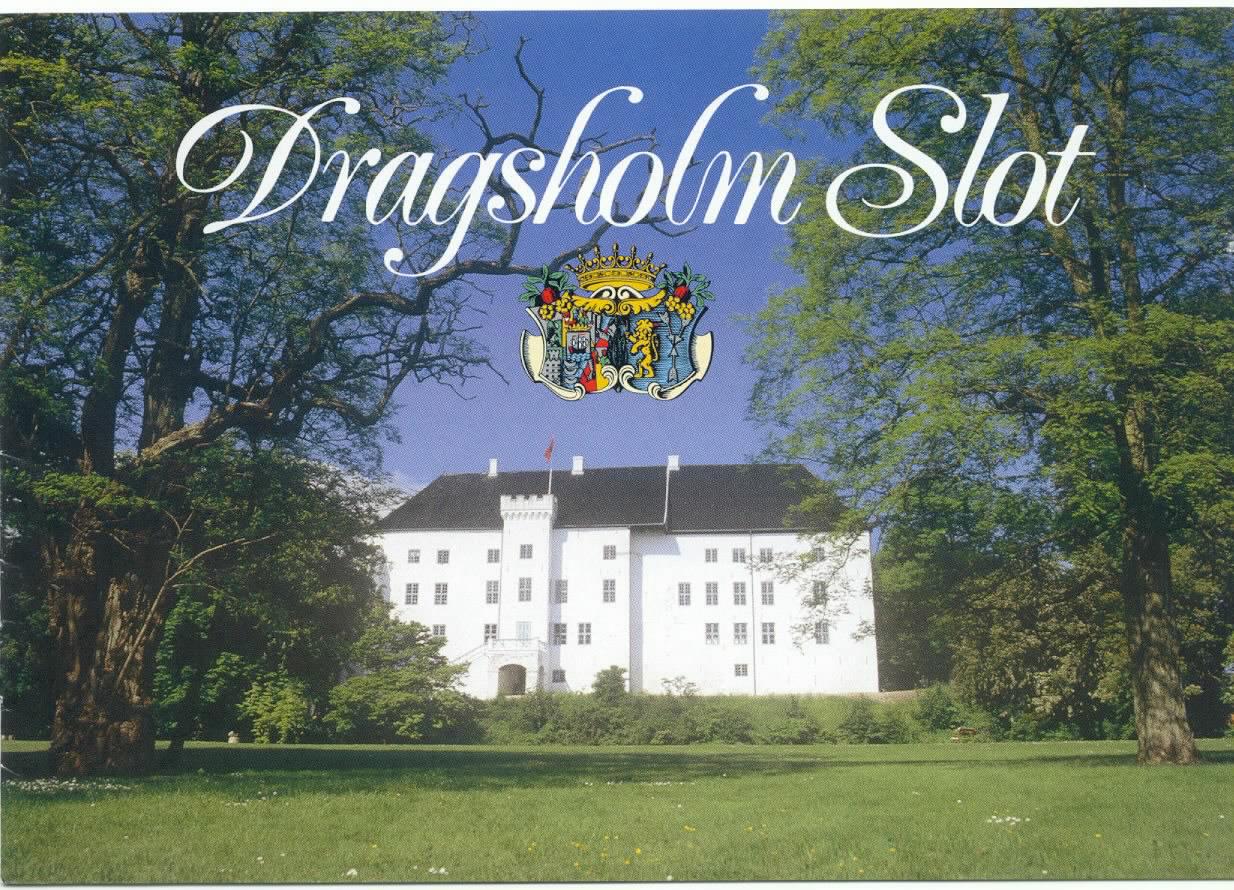 |
Abb. 7 Foto Schloss Dragsholm
Die Familie des Oberst Daniel Hebron
Dieser Alexander Hepburn, wie oben beschrieben, der Bruder des
Schottischen Großadmirals Earl James Hepburn kam nach Pommern,
heiratete dort 1582 Isabella Wachtel und nannte sich hier Hebron.
Sie hatten zwei Söhne Jacob und Daniel. Der eine ist der hier
beschriebene Daniel Hebron *16.10.1584 in Stargard + 08.07.1628 in
Stargard und begraben vor der Kirche in Sageritz Kreis Stolp/POM.
Von Jacob ist lediglich bekannt dass er auch im Militärwesen tätig
war. Er wird für die Zeit kurz nach 1600 als Kur-Brandenburgischer
Oberst im Pommerschen Heldenregister von 1745 aufgeführt. Die
Eltern von Oberst Daniel Hebron sind der Patrick Hepburn, 3. Earl
of Bothwell *1512g +03.11.1556 und Agnes Sinclair, die Tochter von
Lord Henry Sinclair. Oberst Daniel Hebron war seit 1622
verheiratet mit Erdmuth von Gottberg. Sie hatten zwei Töchter.
Anna Katharina war später verheiratet mit Martin Döring von
Krockow auf Wusseken, einem kaiserlichen Oberstleutnant. Von der
zweiten Tochter Elisabeth ist lediglich bekannt, dass sie die
zweite Frau des Präpositus Petrus Vanselow zu Kammin war und 1646
gestorben ist. Dadurch, dass der Sargdeckel mit Inschrift erhalten
ist, können die persönlichen Daten *1584 + 8.07.1628 in Stargard
genau bestimmt werden. Die Bestattung erfolgte in dem Kirchspiel
Dorf Sageritz Kreis Stolp/POM zu dem die ihm gehörenden Güter
Damnitz (später Hebron-Damnitz), Benzin und Carstnitz gehörten.
Die Teile des zerbrochenen Sargdeckels liegen heute im Muzeum
Pomorza Srodkowego w Sluspku" ,Polen, früher Stolp/POM. Ich habe
diesen dort erstmals im Mai 2001 selber besichtigt. Beim Studium
der beiden Bücher von Th.A. Fischer kommt der Name Hepburn u.a.
vor in den Kapiteln: Church für den Priester Hepburn um 1500, in
der Anlage Handwerker in Posen 1605 für Edward Hebron (Hepburn),
in der Anlage Liste der Offiziere bei Gustav Adolf für Colonel Sir
J. Hepburn, im Verzeichnis der Seminarteilnehmer im Kloster
Ratisbon 1838 Guil Hepburn red., in der Liste der Schottischen
Studenten der Universität Frankfurt/Oder 1587 mit M.Jacobus
Helbron (Hepburn), im Kapitel Schottische Händler (hier erbt 1657
Christina Hebron/Hepburn ¾ des Vermögens von George Kilfauns) im
Kapitel Army, Church and oster Matters wird George Hepburn (als
Goldschmied aufgeführt) und im Kapitel Dokumente, wo beschrieben
ist, dass die Schotten in Danzig 1599 (Geo. Hebron/Hepburn) das
Stimmrecht (Bürgerrechte) erhalten haben. Ob es Verbindungen zu
diesen Namensvettern gab ist nicht bekannt. Der andere Obrist Sir
John Hepburn stammte übrigens nicht aus der Linie der Bothwells,
sondern aus der Familie der Hepburns of Athelstaneford, einer
Nebenlinie des Waughton Clans (einiges darüber in: Life of Sir
John Hepburn by James Grant, 1851).
Kurzbiographien über den Obristen des Dreißigjährigen Krieges
Sir John Hepburn
Sir John Hepburn stand von 1620-1623 in böhmisch-pfälzischen,
von 1625-1629 in dänischen (ab 1625 als Oberst), von 1629-1632 in
schwedischen und von 1632-1636 in französischen Diensten. In
zeitgenössischen Quellen wird er häufig als Obrist Hebron"
bezeichnet (nicht zu verwechseln mit dem kaiserlichen Obristen
Daniel Hebron [alias Hepburn, 1584-1628], der von 1625 bis 1628
ein Regiment deutscher Arkebusiere führte. Die einzige konkrete
Nachricht über John Hepburns dänische Militärkarriere datiert vom
29. Juli 1626, als in einem Gefecht bei Rössing, unweit des
Schlosses Calenberg (Nähe Hildesheim) eine bayerische
Kavallerieeinheit unter dem Grafen Egon von Fürstenberg ein
dänisches Armeekorps besiegte, wobei Hepburn in Gefangenschaft
geriet, sich aber wenig später ranzionieren (freikaufen) konnte.
(Hinweis bei Lahrkamp/Gronsfeld, S. 88) Ab 1629 (nach dem Frieden
von Lübeck zwischen Dänemark und dem Kaiser) trat der gebürtige
Schotte in die Dienste des Schwedenkönigs Gustav Adolf, bei dem er
im Jahr 1631 Nachfolger von Sir Donald Mackay, Lord Reay, als
Kommandeur der Schottischen Brigade wurde. Beim Sturm auf
Frankfurt an der Oder (23.4.1631) zeichnete sich John Hepburn in
vorderster Linie kämpfend aus und in der Schlacht bei Breitenfeld
(7./17.9.1631) kommandierte er erfolgreich die Schottische Brigade
mit den Regimentern Robert Monro, James (Jakob) -> Ramsay und
John ->Hamilton (dazwischen je 5 Kompanien zu Pferd unter
Oberst Georg von ->Uslar) in der Mitte des zweiten Treffens der
schwedischen Schlachtordnung. In (Oluf Hansons Plan in Theatr.
Europ. II, S 423) steht, nach der Einnahme Münchens durch die
Schweden (17.5.1632) war Hepburn vorübergehend Kommandant der
bayerischen Hauptstadt, geriet aber bereits zu diesem Zeitpunkt in
Differenzen mit dem Schwedenkönig Gustav II. Adolf. Hepburn
quittierte schließlich seinen schwedischen Dienst, weil er sich
als Katholik von Gustav Adolf wegen seiner Religion zurückgesetzt
glaubte. Spätere Historiker schrieben diesen Schritt der
patriotischen Gesinnung Hepburns zu - tatsächlich ging es jedoch
eher um den Anspruch auf Beförderung, den Hepburn zu haben
glaubte, dem ihm der Schwedenkönig aber verweigerte. Nach Soden
wurde er von Gustav Adolf am 10. Juli 1632 persönlich entlassen
und das Regiment seinem damaligen Oberstleutnant Adam von Pfuel
übergeben (s. auch Brzezinki/Lützen S. 23 Anm. 9) Fr. Frh. v.
Soden beschreibt u.a. in Gustav Adolf und sein Heer in
Süddeutschland" dass bei der Schlacht an der Alten Veste bei
Zirndorf (3.9.1632) Hepburn deshalb nur noch nur als Zuschauer im
Gefolge des Königs teilnahm (Bd. I, S. 384, nach Bougeane I, S.
263). Bei dieser Gelegenheit und in Anbetracht der gefährlichen
Gesamtsituation ersuchte ihn Gustav Adolf, eine von Herzog
Bernhard von Weimar eroberte Höhe zu rekognoszieren. Hepburn
antwortete, er habe zwar keinen Dienst mehr zu leisten, da der
Auftrag aber Gefahr in sich berge, wolle er ihn übernehmen. Nach
Hartes Überlieferung nahm Hepburn die Höhe in Augenschein und
meldete, dass der Feind von hier mit Vorteil bedroht werden könne.
Daraufhin begab sich Gustav Adolf persönlich auf die Anhöhe,
worauf Hepburn seinen Degen in die Scheide steckte und zu ihm
sagte: "Nun, Sire, ist mein Auftrag erfüllt; von nun an ziehe ich
mein Schwerdt nicht mehr für Sie." Gustav Adolf antwortete ihm
nicht. Hepburn verließ kurz nach dieser Begebenheit zusammen mit
dem englischen Gesandten das schwedische Heer und reiste nach
Frankreich. Im Jahr 1633 trat Hepburn Oberst in französischen
Dienste, war ab Mitte 1635 Maréchal de Camp (Generalmajor) und
brachte es schließlich noch bis zum Maréchal de France
(Feldmarschall). Nach Harte blieb Hepburn in einem Zweikampf, was
jedoch absolut unzutreffend ist. Er fiel am 9./19.Juni 1636 bei
einem missglückten Sturm auf Zabern (Saverne)
Sir John Hepburn stirbt in der Schlacht bei Savernes und
Zabern
Wie sich jetzt herausgestellt hat, handelt es sich in der
Englisch/Schottischen Literatur in der Regel um Sir John Hepburn.
In den Büchern von Th. A. Fischer Scots in Germany" und The
Scots in Eastern an Western Prussia" tauchen die Namen Hepburn,
Hebron, Heburn und Bothwell mehrmals auf. 1378 gibt es den Namen
von Adam de Heburn als Seefahrer und Ritter auf dem Weg nach
Preußen. In der Zeit des Dreißig jährigen Krieges 1618-1648 gab es
die schottischen Brigaden, die an unterschiedlichen Fronten
gekämpft haben. Der Autor Fischer beschreibt den Colonel Hepburn,
der später sogar Maréchal of France" war, als jungen, gut
ausgebildeten Mann, der aus einer noblen katholischen schottischen
Familie stammt. Er wird als Siegertyp beschrieben. Schon bevor er
für den Schwedischen König in den Krieg zog, war er mit seinen
Truppen für König Friedrich von Böhmen (1619) gegen Stanislaus von
Polen tätig. Er befehligte die zweite Brigade die Hepburn's
scottish Brigarde oder Green Brigade, von insgesamt 13 Regimentern
des Gustav II. Adolf von Schweden im dreißigjährigen Krieg. Es
wird u.a. der Sieg bei Stralsund und der Rückzug nach Wolgast
(1929) beschrieben. Er stellte dann in der Nähe von Rügenwalde aus
den dortigen Gutsbesitzern und Bauern eine kleine, gut
ausgebildete Armee für Gustav Adolf auf. Die schottischen
Highlender marschierten inzwischen über Schiefelbein nach Kolberg.
Die ersten Heldentaten der neu formierten schottischen Brigade war
die gewonnene Schlacht um Frankfurt/Oder und Landsberg. Hier wurde
Hepburn am Bein verwundet. Hepburn marschierte gegen Leipzig
(1631). Hier wird eine besondere Schlachtformation von Hepburn
erwähnt. Er formte ein Rechteck (square) mit seinen Truppen und
war so gegen die angreifenden Österreicher erfolgreich. Gustav
Adolf dankte der Green Brigade" ähnlich einem Triumpf". Beides
gleicht Kriegsberichten bei den Römern. Am 11. September 1631 nahm
Hepburn die Stadt Leipzig ein. Von hier aus ging es weiter nach
Halle, Thüringen und Würzburg. Gustav Adolf ließ die hier
erbeuteten Kostbarkeiten aus der Bibliothek der Jesuiten nach
Upsala schaffen. Hepburn wandte sich von hieraus mit seiner
Brigade zum Rhein und kam über Oppenheim nach Mainz. Nach der
Einnahme von Mainz blieb Hepburn hier bis März 1632. Dann ging es
über Donauwörth und Augsburg nach München. Am 07. Mai 1632 wurde
Hepburn zum Gouverneure der Stadt München ernannt. Hier wird von
einem Spaziergang mit seinem Freund und Studienkollegen von der
Universität Cambridge berichtet, der auch Kommandeur eines
Schottischen Regimentes war. Im Juni 1632 wurde die gesamte
protestantische Armee von Gustav Adolf in Nürnberg zusammen
gezogen. Nach einem Treffen mit Gustav Adolf bei Neustadt, kam es
zu einer folgenschweren Entscheidung von Hepburn. Er verließ die
schwedischen Dienste. Hepburn wollte den angesagten Kampf gegen
die Kaiserlichen und hier im besonderen gegen die Böhmische
Königin, einer schottischen Prinzessin, nicht mittragen. Es war
nach Fischer nicht die andere Religion, sondern die Treue zum
schottischen Adel, die Hepburn umschwenken ließ. Hepburn bot nun
seine Dienste dem Französischen König an, der zu diesem Zeitpunkt
Verbündeter der Schweden war. Nach einem Aufenthalt in Paris
marschierte Hepburn mit seiner neu formierten Armee (Régiment
d'Hébron) ins Elsass und nach Heidelberg. 1635 wurde diese
Französische Armee mit La Valette, Bernhard von Weimar und Hepburn
entscheidend geschlagen. Obwohl ihn König Ludwig der XIII. noch
zum Maréchal de France machte war seine erfolgreiche Zeit vorbei.
Die letzten Heldentaten seiner Armee, waren die Siege von Savernes
und Zabern. Hier fiel er in einer Schlacht im Nahkampf. Als
Bericht zu seinem Tod gibt es einen Brief von Richelieu an La
Valette vom 20. Juli 1636 an.
Zusammenfassung
Nach jahrelangen Recherchen haben sich die bruchstückhaft
bekannten und im Dorf Sageritz Kreis Stolp/POM. mündlich
überlieferten Aussagen, das der Oberst Daniel Hebron aus dem
Dreißigjährigen Krieg unter der Dorflinde auf dem Dorfplatz vor
der Kirche begraben liege, bestätigt. Zu Beginn meiner Arbeit
konnte ich mir nicht vorstellen, dass vor dem Gehöft meiner
Eltern, meinem Geburtshaus, sich ein historisch so bedeutsames
Grab befinden solle. Widersprüchliche Angaben nährten zunächst
meine Zweifel, aber inzwischen sind fast alle Angaben belegt. Es
gab zwei bedeutende Männer im Dreißigjährigen Krieg mit fast
gleichem Namen, den kaiserlichen Obersten Daniel Hebron und den
königl.-schwedischen Obristen, später französischen Maréchal de
France (Feldmarschall) Sir John Hepburn. Hieraus entstanden
Verwechselungen, die viele Aussagen zweifelhaft erscheinen ließen.
Glückliche Umstände haben es gefügt, dass heute im Jahre 2004, die
Geschichte zweier historischer Gestalten im 17. Jahrhundert
beschrieben, und Missverständnisse aufgeklärt werden konnten. Eine
Karte (Abb. 8) zeigt das Deutsche Reich 1630-1632, also aus der
unmittelbaren Zeit des Daniel Hebron. Hier ist neben seiner
Heimatstadt Stargard auch die Stadt Stolp in Hinterpommern, die er
1628 zum Treuhänder seiner Stiftung machte, eingezeichnet.
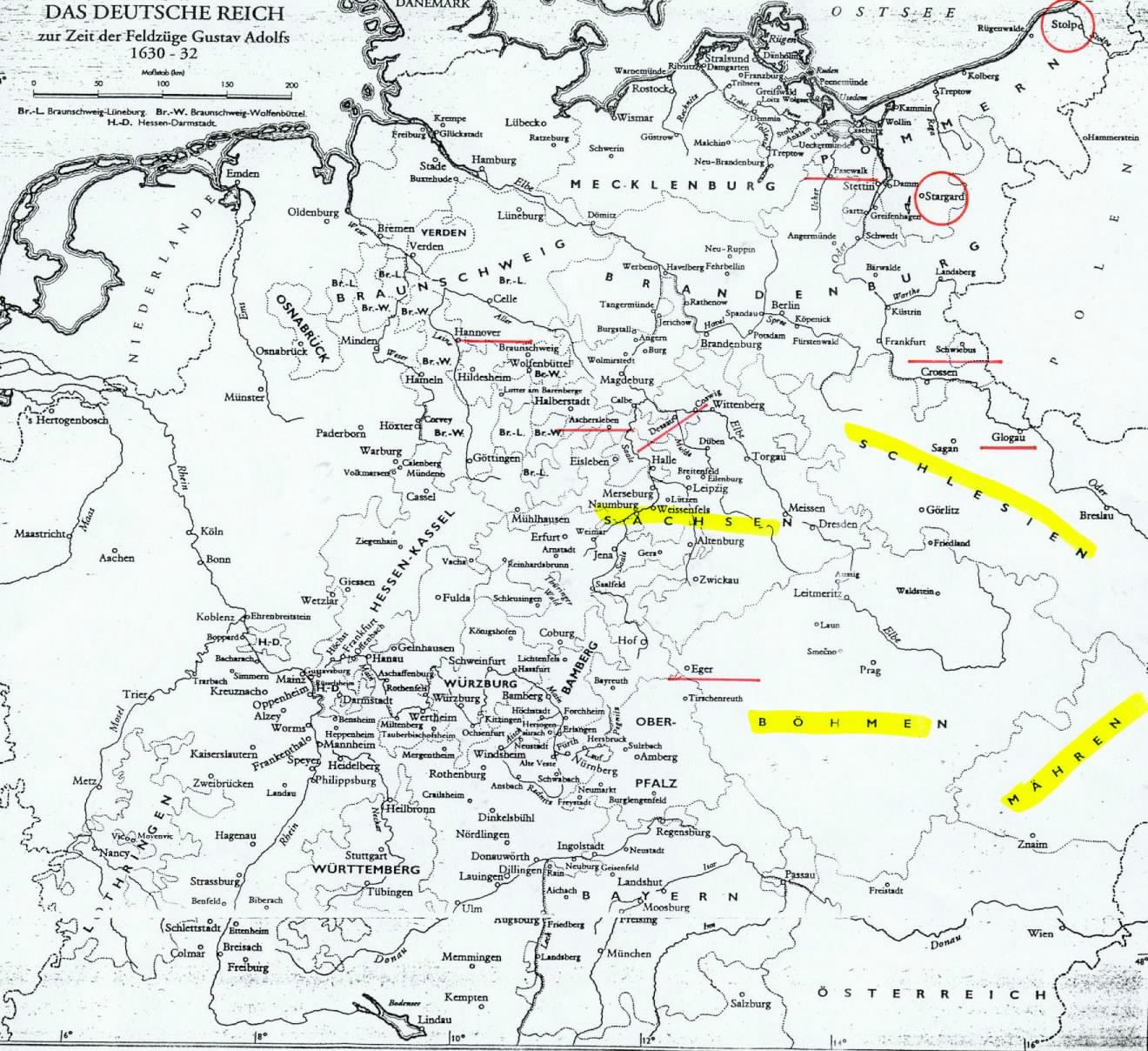 |
Abb. 8 Landkarte Deutsches Reich 1630-1632
Literaturliste
- Arndt Johannes, Der Dreißigjährige Krieg 1618-1648, Stuttgart 2009
- Bekker, E., Maria Stuart, Darley, Bothwell, Giessen 1881
- Cosmus von Simmern, Chronik in Baltische Studien, vierzigster
Jahrgang Abt. Cosmus von Simmern, S.17-67 u. S. 50 Stettin 1890
- Documenta Bohemica Bellum Tricennale Illustrantia, DBBTI in
herausgegeben von der Academia Nakladateltvi Ceskoslovenske, hrsg.
von
Miroslav
Toegel, Josef Kollmann, Vladimir Budil, Josef Polisensky u. a., 7
Bände, Prag 1971-1981).
- Engerisser Peter, Der Dreißigjährige Krieg in Schwaben, Franken
und der Oberpfalz 1631 - 1635. Weißenstadt 2004
- Engerisser Peter, Der Dreißigjährige Krieg in Schwaben, Franken
und der Oberpfalz 1631 - 1635, Ergänzungen durch E-Mail Peter
Engerisser v. 16.05.2004
- Fischer, Th. A. The Scots in Eastern and Western Prussia, S.98,
Edingburg 1903
- Fischer, Th.A. The Sots in Germany, Edinburgh 1902
- Fischer, Th.A. The Sots in Germany, Kapt. The Army S.70,
Edinburgh 1902
- Fischer Th. A., The Scots in Eastern and Western Prussia,
Edingburg 1903
- Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte, 9. Auflage,
München 1999
- Harte Walter, Gustav Adolph Bd.II S. 391 (Bei Fronmüller S.
47).
- Kampmann, Christoph, Europa und das Reich im Dreißigjährigen
Krieg, Stuttgart 2008
- Lista Kaiserischer Kriegs Armada, LKKA S. 418-435, offizielle
Regimentslisten
- Muzeum Pomorza Srodkowego w Sluspku, Katalog Mecenat
artystyczny szlachty pomorskiej s1998
- Peters Jan, Ein Söldnerleben im Dreißigjährigen Krieg, Berlin
1993
- SEDINA-ARCHIV Nr. 4/1974 Familiengeschichtliche Mitteilungen,
Siegfried von Boehn, Geschichte der von Hebron/Hepburn
- Fr. Frh. v. Soden, Gustav Adolf und sein Heer in
Süddeutschland" 10 Bougeane, bei Soden I, S. 384, Brockington S.
389, Khevenhiller XII S. 1974.
- Zeeden, Ernst Walter, Das Zeitalter der Glaubenskämpfe
1555-1648 in Bd. 9 Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte, 9.
Auflage München 1999
Copyright fritz loll
Stand 27.02.2020
zurück zur
Homepage